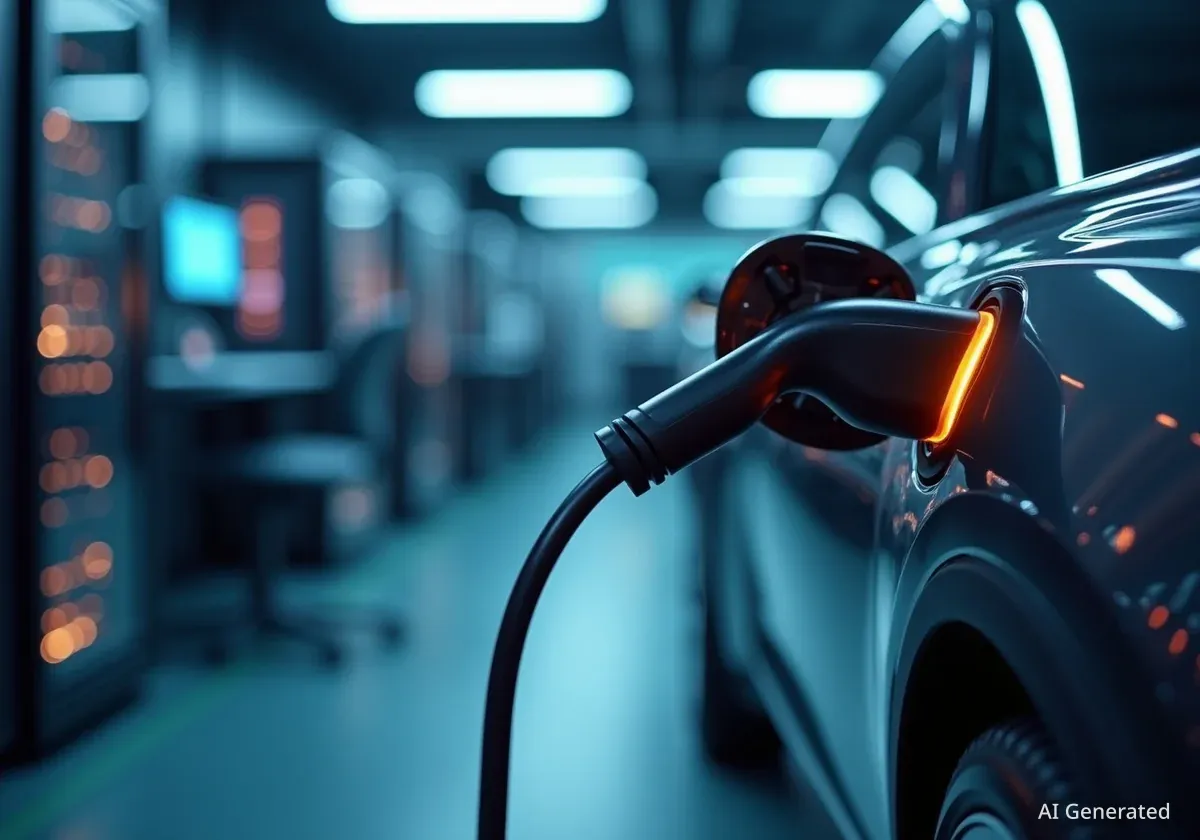Die Unsicherheit über die verbleibende Reichweite von Elektrofahrzeugen, oft als Reichweitenangst bezeichnet, stellt für viele Fahrer eine Herausforderung dar. Selbst bei einer angezeigten Batterieladung von 40 Prozent ist nicht immer klar, ob die Fahrt über einen Bergpass bei kaltem Wetter und hoher Geschwindigkeit sicher abgeschlossen werden kann. Ingenieure der University of California, Riverside (UCR), haben ein neues Diagnosewerkzeug entwickelt, das diese Unsicherheit durch eine verlässliche Reichweitenprognose ersetzen soll.
Dieses innovative System, genannt State of Mission (SOM), bietet eine präzisere Antwort als die herkömmliche Anzeige des Ladezustands. Es berücksichtigt Faktoren wie Höhenunterschiede, Verkehrslage, Außentemperatur und den individuellen Fahrstil, um vorherzusagen, ob ein Elektrofahrzeug eine bestimmte Strecke zuverlässig bewältigen kann. Details zu dieser Forschung wurden in der Fachzeitschrift iScience veröffentlicht.
Wichtige Erkenntnisse
- Das SOM-Tool der UCR bietet eine missionsbezogene Reichweitenprognose für Elektrofahrzeuge.
- Es berücksichtigt Umgebungsfaktoren und Fahrstil für eine präzisere Vorhersage.
- Das System kombiniert maschinelles Lernen mit physikalischen Modellen.
- Tests mit NASA- und Oxford-Daten zeigten eine deutliche Reduzierung von Vorhersagefehlern.
- Die Integration in Fahrzeuge erfordert noch Optimierungen der Rechenleistung.
Präzisere Reichweitenberechnung durch SOM-System
Herkömmliche Batteriemanagementsysteme in Elektrofahrzeugen zeigen in der Regel den aktuellen Ladezustand der Batterie an. Diese Information ist jedoch oft unzureichend, um eine genaue Aussage über die tatsächliche Reichweite unter realen Bedingungen zu treffen. Das SOM-System geht hier einen Schritt weiter, indem es eine missionsspezifische Einschätzung liefert.
Mihri Ozkan, Professorin für Ingenieurwissenschaften an der UCR und Mitentwicklerin des Systems, erklärt:
„Es ist eine missionsbewusste Messung, die Daten und Physik kombiniert, um vorherzusagen, ob die Batterie eine geplante Aufgabe unter realen Bedingungen erfüllen kann.“Dies bedeutet, dass das System nicht nur den Füllstand der Batterie berücksichtigt, sondern auch die Anforderungen der bevorstehenden Fahrt in seine Berechnung einbezieht.
Faktencheck Reichweitenangst
- 40% Ladestand: Kann bei ungünstigen Bedingungen wie Gebirgsfahrten oder Kälte unzureichend sein.
- Reale Faktoren: Höhenunterschiede, Verkehr, Temperatur und Fahrweise beeinflussen die Reichweite erheblich.
- SOM-Ziel: Unsicherheit durch datengestützte, physikalische Prognosen ersetzen.
Technologie hinter dem SOM-System
Die aktuellen Batteriemanagementsysteme basieren entweder auf starren physikalischen Gleichungen oder auf undurchsichtigen KI-Modellen. Das SOM-System der UCR verbindet beide Ansätze und schafft so ein Hybridmodell. Es kombiniert die Flexibilität des maschinellen Lernens mit der Verlässlichkeit von Elektrochemie und Thermodynamik.
Dieses hybride Modell lernt aus dem Verhalten der Batterien über die Zeit. Es analysiert Lade- und Entladezyklen sowie Temperaturschwankungen. Gleichzeitig bleibt es in der physikalischen Realität verankert. Dadurch kann es auch auf unerwartete Ereignisse wie plötzliche Kälteeinbrüche oder steile Anstiege reagieren.
Hintergrund: Batteriemanagementsysteme
Moderne Elektrofahrzeuge nutzen komplexe Batteriemanagementsysteme (BMS) zur Überwachung und Steuerung der Batterie. Diese Systeme schützen die Batterie vor Überladung, Tiefentladung und Überhitzung. Sie sind auch für die Anzeige des Ladezustands (State of Charge, SoC) verantwortlich. Die genaue Reichweitenprognose bleibt jedoch eine Herausforderung, da viele externe Faktoren die tatsächliche Leistung beeinflussen.
Cengiz Ozkan, ebenfalls UCR-Ingenieurprofessor und Co-Leiter der Forschung, betont die Vorteile dieses Ansatzes:
„Indem wir sie kombinieren, erhalten wir das Beste aus beiden Welten: ein Modell, das flexibel aus Daten lernt, aber immer in der physikalischen Realität verankert bleibt.“ Diese Kombination ermöglicht eine präzisere und stabilere Prognosefähigkeit.Ergebnisse und zukünftige Anwendungen
Das Team der UCR hat das SOM-System mithilfe öffentlicher Datensätze der NASA und der Oxford University getestet. Diese Datensätze enthielten reale Batterieleistungsdaten, darunter Lade- und Entladezyklen, Temperaturänderungen, Spannungsdaten und langfristige Trends. Die Ergebnisse waren vielversprechend: Im Vergleich zu herkömmlichen Diagnosetools reduzierte SOM die Vorhersagefehler signifikant.
- Spannung: Fehler um 0,018 Volt reduziert.
- Temperatur: Fehler um 1,37 Grad Celsius reduziert.
- Ladezustand: Fehler um 2,42 Prozent reduziert.
Mihri Ozkan fasst die Bedeutung zusammen:
„Es wandelt abstrakte Batteriedaten in umsetzbare Entscheidungen um und verbessert so die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Planung für Fahrzeuge, Drohnen und jede Anwendung, bei der Energie an eine reale Aufgabe angepasst werden muss.“Vorteile des SOM-Systems
- Geringere Fehlerquote: Präzisere Vorhersagen bei Spannung, Temperatur und Ladezustand.
- Erhöhte Sicherheit: Verhindert unerwartetes Liegenbleiben durch leere Batterie.
- Bessere Planung: Ermöglicht optimierte Routenplanung und Ladestopps.
- Vielseitigkeit: Anwendbar in E-Fahrzeugen, Drohnen und Stromspeichern.
Das System befindet sich noch in der Entwicklung. Eine der größten Herausforderungen ist der erhöhte Rechenaufwand, den es benötigt. Dieser übersteigt die Kapazitäten der meisten aktuellen, leichtgewichtigen Batteriesysteme in Elektrofahrzeugen. Das UCR-Team ist jedoch optimistisch, dass SOM durch weitere Optimierungen in EVs, Drohnen und Stromspeichersysteme integriert werden kann.
Die Forscher untersuchen auch, wie SOM mit neuen Batterietechnologien wie Natrium-Ionen-, Festkörper- und Flussbatterien zusammenarbeiten kann. Cengiz Ozkan ist überzeugt:
„Der gleiche hybride Ansatz kann die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz in einer Vielzahl von Technologien verbessern, von Autos und Drohnen bis hin zu Heimbatteriesystemen und sogar Weltraummissionen.“Diese Entwicklung könnte die Alltagstauglichkeit von Elektrofahrzeugen erheblich steigern und die Akzeptanz der Elektromobilität weiter fördern, indem sie eine der größten Sorgen der Nutzer, die Reichweitenangst, adressiert.