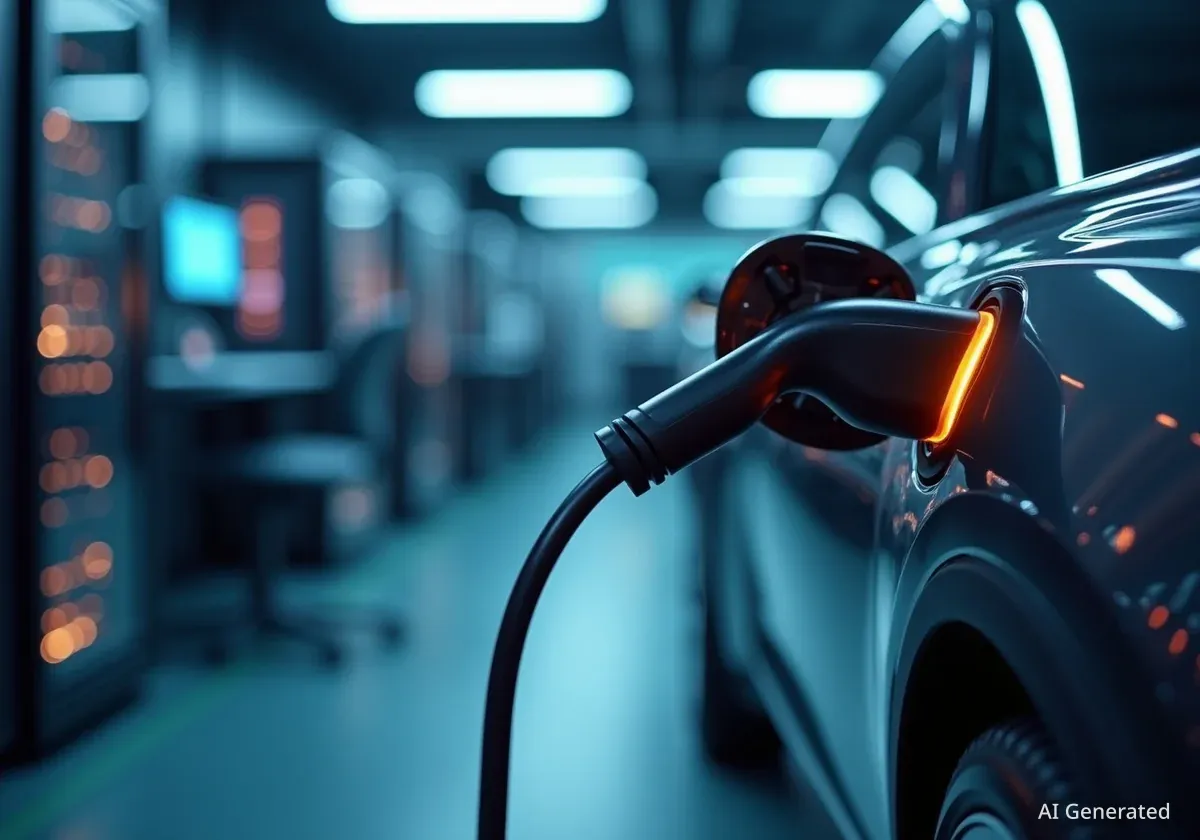Mercedes-Benz engagiert sich weiterhin stark für emissionsfreies Fahren und entwickelt mit seinem experimentellen Ladefahrzeug ELF (Experimental Lade Fahrzeug) zukunftsweisende Ladetechnologien. Dieses speziell entwickelte Testfahrzeug ermöglicht die Erforschung von CCS-Hochleistungsladen, MCS-Megawattladen, kabellosem Laden sowie AC- und DC-Fahrzeug-zu-Netz-Technologien (Vehicle-to-Grid). Die Erkenntnisse aus diesen Tests fließen direkt in die Entwicklung künftiger Elektrofahrzeuge und der Ladeinfrastruktur ein.
Wichtige Erkenntnisse
- Der Mercedes-Benz ELF ist ein mobiles Testlabor für innovative Ladetechnologien.
- Er unterstützt CCS- und MCS-Laden, kabelloses Laden und bidirektionales Laden.
- Forschung zielt auf extrem schnelle Ladezeiten und verbesserte Effizienz ab.
- Bidirektionales Laden ermöglicht es Elektrofahrzeugen, Energie ins Netz oder Haus zurückzuspeisen.
- Ergebnisse der Tests werden in zukünftige Serienmodelle und Ladeparks integriert.
Ein umfassendes Testlabor für Elektromobilität
Der ELF ist mehr als nur ein Fahrzeug. Mercedes-Benz bezeichnet ihn als Symbol einer neuen Ära im Laden von Elektrofahrzeugen. Das mobile Testlabor vereint ultraschnelles, bidirektionales, solares, induktives und konduktives Laden in einem ganzheitlichen Konzept. Ziel ist es, die Grenzen des technisch Machbaren neu zu definieren.
Die Entwicklung konzentriert sich nicht nur auf die reine Ladeleistung, die ein Elektrofahrzeug aufnehmen kann. Hersteller werben oft mit Spitzenwerten von 400 kW oder mehr. In der Praxis können diese Werte jedoch aufgrund verschiedener Faktoren wie Umgebungstemperatur, Batterietemperatur, Sicherheitsprotokollen des Batteriemanagementsystems und Bedenken hinsichtlich der Batterielebensdauer auf 100 kW oder weniger sinken. Auch die Ladeinfrastruktur selbst spielt eine Rolle. Die Ladeleistung kann variieren, je nachdem, wie viele andere Fahrzeuge gleichzeitig am selben Standort laden.
Faktencheck
- 900 kW: Ziel-Ladeleistung für CCS-Systeme im ELF, um Ladezeiten auf etwa 10 Minuten zu reduzieren.
- 1.041 kW: Spitzenladeleistung, die das Concept AMG GT XX bei Megawattladung erreichte.
- 500 Euro: Geschätzte jährliche Einsparungen bei Energiekosten durch bidirektionales Laden im Eigenheim.
Ladeequipment und Kabel, die hohe Stromlasten transportieren, erhitzen sich und benötigen während des Betriebs Kühlung. Der Ladevorgang eines Elektrofahrzeugs ist ein komplexes Zusammenspiel mehrerer Komponenten. Alle Beteiligten müssen synchronisiert sein, damit der Prozess reibungslos abläuft. Mercedes-Benz führt diese Experimente durch, um zukünftige Ladeprotokolle zu definieren, die den Übergang zur Elektromobilität optimieren sollen.
CCS- und MCS-Systeme im Fokus
Der ELF ist mit zwei Schnellladesystemen ausgestattet: CCS (Combined Charging System) und MCS (Megawatt Charging System). CCS ist der aktuelle Standard für Personenkraftwagen und erreicht typischerweise maximal 350 bis 400 kW. Der ELF erforscht Möglichkeiten, diese Leistung auf bis zu 900 kW zu steigern. Dies würde eine typische Ladesitzung auf etwa 10 Minuten verkürzen.
Der Testtransporter dient dazu, Komponenten wie Kabel, Stecker, Kühlung und Ladesteuerungen zu erproben. Laut Mercedes-Benz sind diese Komponenten kurz vor der Serienreife und sollen bald in Elektrofahrzeuge integriert werden. Darüber hinaus kann der ELF das Megawatt-Ladesystem (MCS) nutzen, das für Schwerlastwagen entwickelt wurde und Leistungen von über 1.000 kW ermöglicht.
„Elektromobilität ist mehr als nur Technologie – sie steht für Verantwortung gegenüber der Umwelt, der Gesellschaft und zukünftigen Generationen. Das Laden muss effizient, intelligent und nachhaltig sein. Deshalb arbeitet Mercedes-Benz konsequent an innovativen Ladelösungen für Zuhause, den Arbeitsplatz und öffentliche Räume – und gestaltet aktiv die Zukunft des Ladens.“
Mercedes-Benz in einem Blog-Beitrag über den ELF
Der ELF wird eingesetzt, um die thermische Belastbarkeit und Leistungsgrenzen von Hochvoltbatterien, Leistungselektronik, Ladekabeln und anderen Komponenten unter extremen Bedingungen zu testen. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Entwicklung von Langstreckenfahrzeugen und Flottenlösungen ein. Mercedes-Benz verfolgt mit der Kombination von MCS und CCS einen dualen Forschungsansatz.
Einerseits werden neue technologische Horizonte erkundet und die Technologie der Zukunft entwickelt. Andererseits wird die Serienreife bestehender Systeme verbessert. Dies trägt zur Optimierung des heutigen Ladeerlebnisses bei. Ein Beispiel für die Anwendung dieser Forschung ist das Mercedes Concept AMG GT XX. Dieses Fahrzeug kann in etwa fünf Minuten 400 Kilometer Reichweite nachladen. Es nimmt über einen Großteil der Ladekurve 850 kW bei 1000 Ampere auf. In einem aktuellen Test erreichte es eine Spitzenladeleistung von 1.041 kW während des Megawattladens.
Hintergrundinformationen zur Ladeinfrastruktur
Die Verfügbarkeit und Effizienz der Ladeinfrastruktur sind entscheidend für die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen. Schnelle und zuverlässige Ladevorgänge sind für Verbraucher ebenso wichtig wie die Reichweite der Fahrzeuge. Die Entwicklung von Hochleistungsladesystemen wie CCS und MCS ist ein wichtiger Schritt, um Elektrofahrzeuge alltagstauglicher zu machen und die Ladezeiten an die von konventionellen Tankvorgängen anzugleichen.
Mercedes-Benz hat in Zusammenarbeit mit Alpitronic einen Prototyp einer Hochleistungsladestation entwickelt. Diese kann über ein CCS-Kabel bis zu 1.000 Ampere liefern, was dem Doppelten der bisher möglichen Leistung entspricht. Dazu wurde ein MCS-Ladegerät mit einem CCS-Stecker nachgerüstet, wobei die Kühlleistung von Stecker und Kabel beibehalten wurde. Forschungsteams simulierten den Prozess in einem Test- und Validierungsprotokoll, bevor der Praxistest begann.
Die Erkenntnisse aus dieser Prototyp-Ladestation fließen direkt in die Entwicklung einer neuen Generation von Hochleistungs-Schnellladern ein. Diese sollen in Mercedes-Benz Ladeparks zum Einsatz kommen. Kunden sollen von extrem schnellen Ladevorgängen profitieren, deren Ladezeiten sich nur minimal von herkömmlichen Tankvorgängen unterscheiden. Kürzere Ladezeiten bedeuten größere Flexibilität auf Reisen und einen deutlichen Komfortgewinn im Alltag. Mercedes-Benz unterstreicht damit seine Innovationskraft und will zukünftig neue Standards für das öffentliche Laden setzen.
Bidirektionales Laden: Das Elektrofahrzeug als Energiespeicher
Bidirektionales Laden ist ein strategischer Hebel für die Energiewende. Mit dem ELF erforscht Mercedes-Benz das volle Potenzial dieser Schlüsseltechnologie. Elektrofahrzeuge können nicht nur Strom aufnehmen, sondern ihn auch ins Haus, ins Netz oder direkt an elektrische Geräte zurückspeisen. Dies ermöglicht es Elektrofahrzeugen, ein aktiver Teil eines nachhaltigen Energiesystems zu werden. Zukünftig bieten sie Kunden mehr Unabhängigkeit und potenzielle Kosteneinsparungen.
Der ELF testet bidirektionales Laden in realen Szenarien. Die Ergebnisse fließen direkt in die Serienentwicklung zukünftiger Modelle ein. Der ELF ist sowohl zum bidirektionalen AC- als auch zum DC-Laden fähig. AC ermöglicht die Stromversorgung von Fahrzeug zu Last (V2L). Hierbei versorgt die Traktionsbatterie direkt Geräte wie Elektrowerkzeuge oder Außenbeleuchtung. Mithilfe einer bidirektionalen AC-Wallbox werden auch Vehicle-to-Home (V2H) und Vehicle-to-Grid (V2G) Anwendungen möglich.
- V2L (Vehicle-to-Load): Das Fahrzeug versorgt externe Geräte mit Strom.
- V2H (Vehicle-to-Home): Das Fahrzeug speist Energie ins Hausnetz ein.
- V2G (Vehicle-to-Grid): Das Fahrzeug speist Energie ins öffentliche Stromnetz ein.
Eine Herausforderung bei V2G-Systemen ist die komplexere Standardisierung. Das Fahrzeug muss die Anforderungen verschiedener Stromnetze erfüllen. DC ermöglicht es einem Fahrzeug, direkt mit privaten Solaranlagen und Batteriespeichern zu interagieren. Wenn ein Haus bereits über diese Einrichtungen verfügt, ist es einfacher, die in der Fahrzeugbatterie gespeicherte Energie zur Unterstützung des Netzbetriebs zu nutzen, auch wenn die anfänglichen Kosten für das entsprechende Wandladegerät und den Wechselrichter höher sein können.
Der ELF verfügt über die Fähigkeit zum bidirektionalen DC-Laden, um die damit verbundenen technischen Herausforderungen besser zu verstehen. Der neue CLA mit EQ-Technologie und der neue GLC mit EQ-Technologie sind bereits für bidirektionales Laden mit einer kompatiblen DC-Wallbox ausgestattet. Im Jahr 2026 wird Mercedes-Benz seine ersten Dienste für bidirektionales Laden in Deutschland, Frankreich und Großbritannien einführen, weitere Märkte sollen folgen.
MB.CHARGE Home kombiniert Fahrzeug, bidirektionale Wallbox, Ökostromtarif und Energiemarktzugang. Dies soll Haushaltskosten senken und die Netzstabilität unterstützen. Dank intelligenter Steuerungen und einer App können Fahrzeuge nicht nur kostenoptimiert laden, sondern auch Energie in das Heimnetz oder Stromnetz zurückspeisen. Dies verwandelt Elektroautos in aktive Energiespeicher und trägt zur Energiewende bei. Ein Elektrofahrzeug von Mercedes-Benz besitzt eine Batteriekapazität von 70 bis 100 kWh. Dies reicht aus, um ein durchschnittliches Haus im V2H-Modus zwei bis vier Tage lang mit Strom zu versorgen.
Wird eine private Solaranlage genutzt, kann überschüssiger Strom in der Autobatterie für eine spätere Nutzung gespeichert werden. Der bidirektionale Betrieb kann Hausbesitzern etwa 500 Euro pro Jahr an Energiekosten einsparen. Mercedes-Benz betont, dass Elektrofahrzeuge eine zentrale Rolle in der Energiewende spielen, nicht nur als lokale CO₂-freie Transportmittel, sondern auch als mobile Speicher für erneuerbare Energien. Durch bidirektionales Laden können sie überschüssige Energie aus Wind- und Solarkraftwerken aufnehmen und bei Bedarf wieder ins Netz einspeisen. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für Netzstabilität, Versorgungssicherheit und eine bessere Nutzung erneuerbarer Energiequellen.
Induktives und Konduktives Laden
Der ELF-Versuchstransporter hat noch weitere Funktionen. Neben CCS-, MCS- und V2X-Fähigkeiten ist er auch ein rollendes Testlabor für kabelloses oder induktives Laden. Diese Technologie bietet großes Potenzial, insbesondere zu Hause und für Flottenanwendungen. Sie macht das Laden bequemer und praktisch unsichtbar, so Mercedes-Benz.
Der ELF kann kabellos mit bis zu 11 kW AC laden – ähnlich der Leistung einer typischen Wallbox. Er wird derzeit eingesetzt, um die Alltagstauglichkeit, Effizienz und Kompatibilität mit verschiedenen Fahrzeughöhen und -positionen zu testen. Dies geschieht mit Blick auf den Einsatz in Robotaxi- und Flottenanwendungen. Konduktives Laden nutzt spezielle Ladeplatten im Boden, die mit dem Fahrzeug kommunizieren. Sie helfen dem Fahrer oder dem Parkassistenten, das Fahrzeug korrekt zu parken und den Ladevorgang einzuleiten. Die Energieübertragung erfolgt über eine direkte physikalische Verbindung mittels eines Steckers im Fahrzeugboden. Die Ladeleistung beträgt derzeit 11 kW AC.
Im ELF wurde besonderes Augenmerk auf die Installation des Steckers im Fahrzeugboden und die Positionierungsanforderungen gelegt. Das Fahrzeug muss in einem bestimmten Bereich über der Ladeplatte positioniert werden, um den Ladevorgang zu starten, was ein gezieltes Parken erfordert. Konduktives Laden macht das Anschließen oder Trennen von Ladekabeln überflüssig. Es eignet sich besonders gut für den Einsatz auf engen Parkplätzen. Es führt zu einem ordentlichen Erscheinungsbild und benötigt weniger Platz als herkömmliche Ladestationen. Der effektive Radius ist derselbe wie bei einem kabelgebundenen System und etwas besser als bei induktiven Lösungen.
Automatisches Laden
Mercedes-Benz nutzt den ELF auch, um das robotische Laden zu erforschen. Das Unternehmen erwartet, dass dies eine wichtige Rolle beim Schnellladen spielen wird, sowohl für schwere Fahrzeuge als auch für Premium-Elektroautos, bei denen hohe Ströme und große Kabel zum Einsatz kommen. Es werden automatisierte Ladesysteme erforscht, die es Fahrzeugen ermöglichen, sich präzise, sicher und ohne manuelles Eingreifen mit Ladegeräten zu verbinden. Dies ist ein entscheidender Schritt, insbesondere für Flottenbetreiber, barrierefreie Mobilitätskonzepte und das Premiumsegment.
Diese Entwicklungen sind eng mit der Arbeit der internen Charging Unit von Mercedes-Benz verbunden. Diese Einheit ist für den globalen Rollout des Mercedes-Benz Charging Network verantwortlich. Dieses markeneigene Schnellladenetzwerk konzentriert sich auf Komfort, Zuverlässigkeit und Premium-Service für Fahrer von Elektrofahrzeugen aller Marken. Zweifellos führen auch andere Automobilhersteller ähnliche Experimente durch. Volkswagen führt beispielsweise V2G-Tests in Europa durch, ebenso wie Renault in Utrecht und Schweden mit WeRide. Andere Unternehmen mögen dies ebenfalls tun, auch wenn ihre Bemühungen nicht öffentlich bekannt sind. Das Ladeerlebnis macht das Fahren eines Elektroautos zu einer Freude, wenn es gut funktioniert, aber zu einem Albtraum, wenn es nicht funktioniert. Indem Mercedes-Benz diesen Aspekt des Elektrofahrzeugbesitzes in den Mittelpunkt stellt, trägt das Unternehmen dazu bei, die Elektromobilitätsrevolution voranzutreiben.